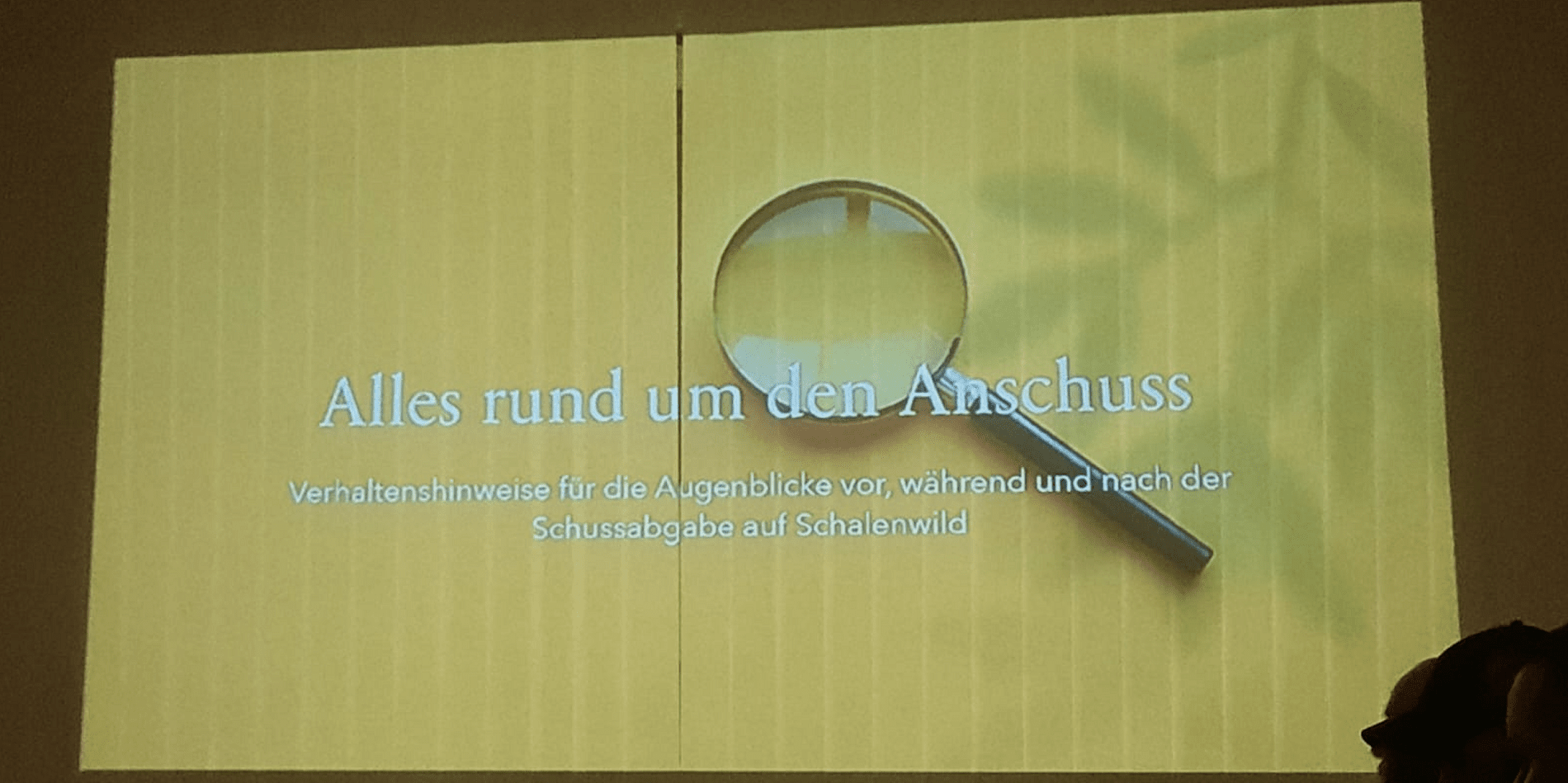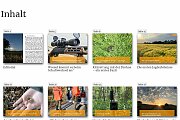Vor einigen Tagen lud Mario Schwark, Revierpächter in Hördinghausen, Gemeinde Bad Essen in Niedersachen zum Anschussseminar ein. Referieren sollte Joel Schwarz. Da dacht ich mir, den kennste, das hörste dir mal an.
Joel ist 46 Jahre alt und besitzt schon viele Jahre den Jagdschein. Er führt zurzeit seinen sechsten Hund. Er ist einer der bestätigten Nachsuchenführer bei uns im Wiehengebirge, aktuell führt er eine Schwarzwildbracke und einen BGS.
Lustig ging es schon los, die Tücken der Technik spielten dem Veranstalter einen Streich. Es dauerte einen kleinen Moment, Rettung nahte. Der Nachbar hatte ein passendes Kabel. Ich dachte, na das kann ja was werden. Als es sich alle 13 Teilnehmer im Feuerwehrhaus in Hördinghausen gemütlich gemacht hatten, ging es los. Alles rund um den Anschuss; Verhaltensweise für die Augenblicke vor, während und nach der Schussabgabe auf Schalenwild, sowie die Verhaltensweise zur Annährung und zum Umgang mit dem Anschuss.
Joel begann mit seinem Vortrag und führte anschaulich sowie praxisnah durch den Abend. Er berichtet, dass seine Hunde nicht, wie ich gedachte habe, auf Schweiß arbeiten, sondern auf der Verwundfährte des jeweiligen Stückes Schalenwild. Das heißt, die Hunde werden so ausgebildet, dass sie in der Lage sind, Krankfährten von Gesundfährten zu unterscheiden. Der Hund erkennt in der Fährte unabhängig, ob Schweiß vorhanden ist, ob das Tier Krankwitterung aufweist oder nicht. Dies ist der Sinn einer Kontrollsuche; der Hund zeigt im Rahmen einer sogenannten Vorsuche, ob das Stück eine Verletzung hat oder nicht.
Natürlich verweist er auch Pirschzeichen wie Knochen, Schweiß oder Gewebe. Er erkennt es dann aber allein durch die Absonderung im Trittsiegel des Stückes. Zum Beispiel Adrenalin oder besondere Hormone. Dies ist erfahrungsgemäß auch noch nach vier Tagen möglich, wenn die Witterung es zulässt, dass die Fährte noch Krankwitterung abgibt.