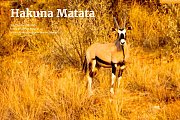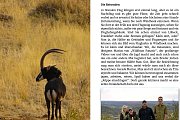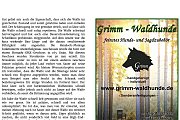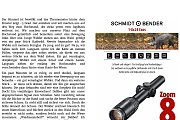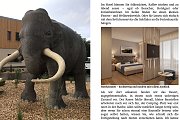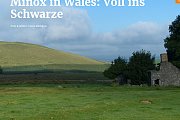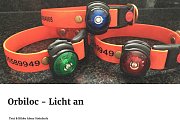Die Verfügbarkeit von Nahrung spielt auch eine essentielle Rolle in Bezug auf die Fortpflanzung. In Mastjahren, in denen es besonders viele Eicheln und Bucheckern gibt, kommen auch viele Siebenschläfer zur Welt. Aus diesem Grund hat man den Bilchen früher eine gewisse Vorhersagekraft zugesprochen. In Wirklichkeit entwickeln Bäume wie Buchen oder Eichen bereits im Herbst Fruchtanlagen und unreife Knospen, aus denen dann im nächsten Jahr die Früchte entstehen. Studien ergaben, dass das Fressen dieser Fruchtknospen von Eicheln und Bucheckern ein Signal sendet, woraufhin in der nachfolgenden Saison die Paarungsbereitschaft beider Geschlechter steigt. So wird schon frühzeitig kalkuliert, wie viel Energie über das Jahr noch verfügbar sein wird und ob man sie in Balz und Jungenaufzucht stecken sollte oder lieber sparsam sein und in den Winterspeck investieren.
Denn Winterspeck ist äußerst wichtig, um die kalte Jahreszeit zu überstehen! Im Herbst fallen Bilche in ihren Winterquartieren in einen tiefen Winterschlaf, bei dem der Stoffwechsel extrem heruntergefahren wird. Ihre Körpertemperatur sinkt dabei bis kurz vor den Gefrierpunkt. Knapp einen Meter unter der Erde, in Steinhöhlen oder Laubnestern verschlafen die sozialen Bilche eng zusammengekuschelt in kleinen Gruppen den Winter. Und das dauert häufig deutlich länger als die besagten sieben Monate. Ein Winterschlaf von Ende September bis Mitte Mai ist keine Seltenheit. Da verwundert es nicht, dass die Schläfer in dieser Zeit 40 bis 50% ihres Körpergewichts verlieren.
Nach dem Winterschlaf kann man die ortstreuen und territorialen Tiere mancherorts anhand ihrer Laute orten. Bis auf die Haselmaus sind Bilche sehr stimmfreudig und kommunizieren über verschiedenste Laute vom Murmeln und Grunzen über keckernde Geräusche bis hin zu Pfeifen. Es geht aber auch leiser wie bei der Haselmaus, die überwiegend im Ultraschallbereich kommuniziert.
Doch nicht immer sorgen die geräuschvollen Bilche für Begeisterung. Gerade Siebenschläfer erklären immer wieder Dachböden zu ihrem Zuhause, häufig zum Leidwesen der menschlichen Mitbewohner. Während man anfangs das nächtliche Tapsen noch gelassen in Kauf nehmen kann, kosten die lautstarken Streitereien schon einige Nerven. Wird dann noch die Dämmung zerfressen, ist es in vielen Wohngemeinschaften schnell aus mit der Sympathie für die pelzigen Kobolde auf dem Dachboden. Wer Hilfe benötigt, sollte nach Möglichkeit Kontakt zu einer nahegelegenen Wildtierstation mit Bilcherfahrung suchen, denn eine Umsiedlung sollte keinesfalls blindlinks erfolgen! Wer die Tiere eigenständig fängt, macht sich strafbar. Zudem wird für eine Umsiedlung eine Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde benötigt. Mit Hilfe eines Experten werden dann Lebendfallen aufgestellt und ein neues geeignetes Habitat ausgesucht, das weit genug von den nächsten Wohnhäusern entfernt ist, denn Bilche finden über weite Strecken zurück. Um dem Spuk auf dem Dachboden ein Ende zu bereiten, ist es wichtig, die ganze Gruppe zu fangen. Viel zu oft wird bei solchen Aktionen vergessen, dass Bilche in Familienverbänden leben, daher gilt: Entweder alle oder keiner. Während des Winterschlafs und zur Zeit der Jungtieraufzucht muss jegliche Störung unbedingt vermieden werden. Das Zeitfenster für Umsiedlungsmaßnahmen ist daher sehr eng. Beim Siebenschläfer ist das Frühjahr für Umsiedlungen am besten geeignet, Gartenschläfer gebären schon kurz nach dem Erwachen ihren Nachwuchs. Bei ihnen muss man den richtigen Zeitpunkt gegen Mitte/Ende August abwarten. Erfolgreiche Umsiedlungen sind folglich sehr aufwändig und benötigen Fingerspitzengefühl gepaart mit einem hohen Maß an Erfahrung, sonst war die ganze Arbeit umsonst. Wem das zu aufwändig ist, der kann sich zunächst einfacher Vergrämungsmaßnahmen bedienen. Als erfolgsversprechend wird häufig ein handelsüblicher WC-Stein diskutiert, der aufgrund des Geruchs die Siebenschläferfamilie dazu bewegen soll, umzuziehen. Wichtig ist, den Stein am Schlafplatz der Bilche so anzubringen, dass er nicht angeknabbert werden kann. Als weitere Alternative sind oft Weihrauchgranulat sowie Essig und Ölessenzen (bspw. Pfefferminz oder Eukalyptus) im Gespräch. Zeitlich sollte eine Duftvergrämung im Mai/Juni oder September/Oktober erfolgen, um Wirkung zu zeigen.
Besonders Siebenschläfer sind anpassungsfähige Kulturfolger und suchen die Nähe des Menschen. Streuobstwiesen, Dachböden und Scheunen sind beliebte Rückzugsorte, die allerdings immer weniger oder schwerer zugänglich werden. Vor allem aber nimmt der eigentliche Lebensraum unserer heimischen Bilche immer mehr ab und die Bestände gehen zurück. Ein großes Problem, das noch zu wenig Beachtung findet. Der Gartenschläfer gilt als Nagetier mit der stärksten Bestandsabnahme in Europa. Die Rote Liste des IUCN stuft ihn als potentiell gefährdet ein. Für alle Bilche sind Gehölze essentielle Elemente in ihrem Lebensraum. Hecken, strauchreiche Flächen und natürliche Mischwälder mit viel Unterwuchs und alten Baumhöhlen fallen vielerorts land- und forstwirtschaftlichen Interessen zum Opfer. Alle Bilche sind durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt und genießen zusätzlich durch die Berner Konvention (Anhang III) internationalen Schutzstatus. Baumschläfer und Haselmaus stehen zusätzlich unter dem Schutz des Anhang IV (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie. Bleibt zu hoffen, dass das Bewusstsein für den Erhalt und Schutz dieser ganz besonderen und liebenswerten kleinen Kobolde weiterhin wächst und die Bemühungen Früchte tragen. Dabei kann jeder schon im Kleinen anfangen, indem er einige Ecken im Garten verwildern lässt, Nistkästen anbringt und flache Wasserschalen aufstellt. Nicht nur Bilche, auch Vögel, Eichhörnchen, viele weitere Tiere und letztlich auch der Mensch werden davon profitieren.